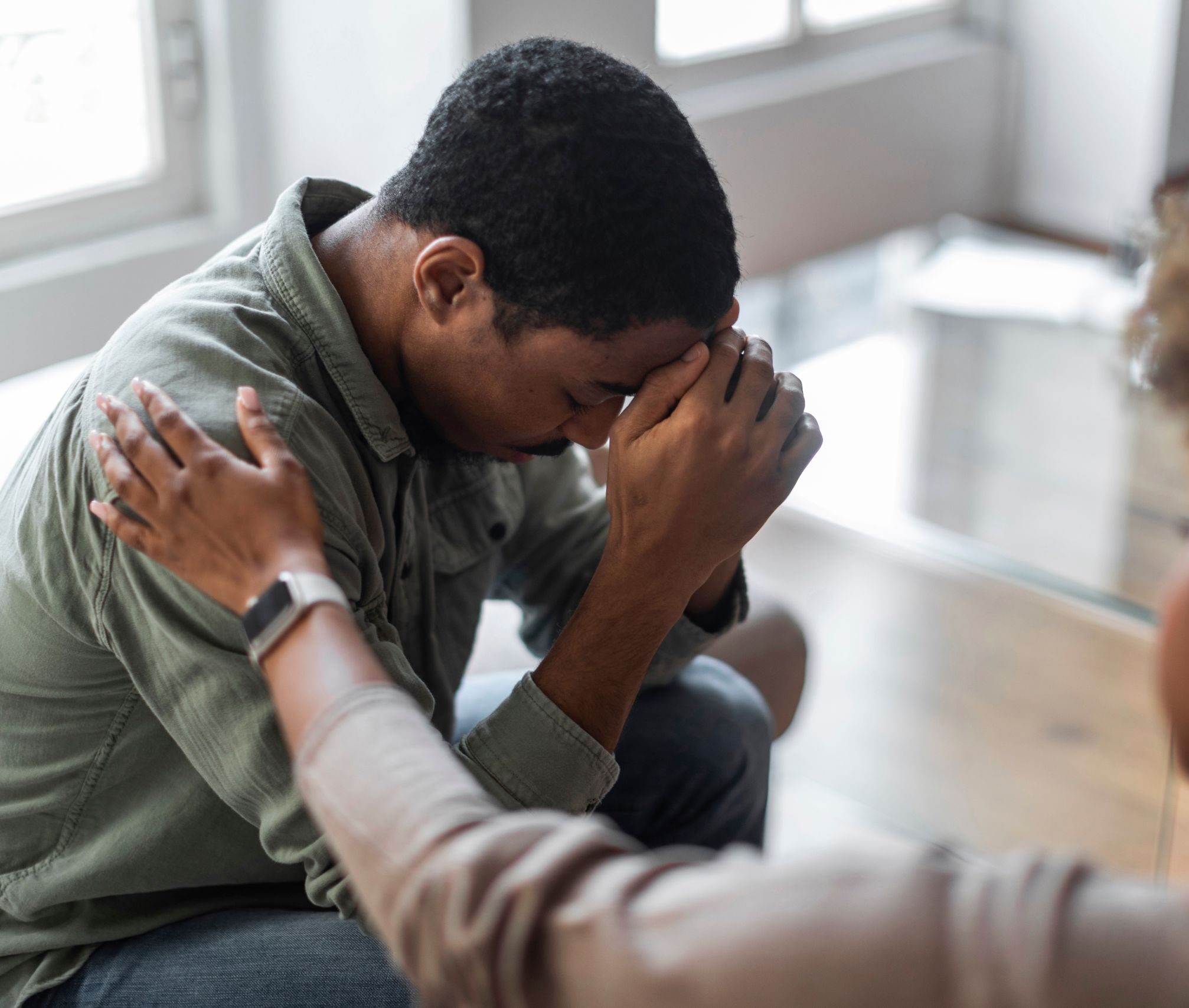Wie unterscheiden sich akute Belastungsreaktion, akute Belastungsstörung und posttraumatische Belastungsstörung?
Alle drei Begriffe bezeichnen psychische Reaktionen auf stark belastende oder traumatische Ereignisse, jedoch mit unterschiedlichen Schweregraden, zeitlichen Verläufen und diagnostischen Kriterien. Sie stammen aus verschiedenen internationalen Klassifikationssystemen für psychische Störungen: Im deutschen Gesundheitssystem wird vor allem die Internationale Klassifikation der Krankheiten (ICD-10) der Weltgesundheitsorganisation verwendet. In den USA ist das Diagnostische und Statistische Manual psychischer Störungen (DSM-5) maßgeblich.
Diese Reaktion tritt unmittelbar nach dem belastenden Ereignis auf, meist innerhalb von Minuten bis Stunden. Betroffene zeigen Symptome wie innere Leere, Rückzug, Desorientierung, Unruhe oder vegetative Beschwerden (z. B. Herzklopfen, Zittern). Die akute Belastungsreaktion ist zeitlich begrenzt und klingt in der Regel innerhalb weniger Stunden bis Tage wieder ab. Sie gilt nicht als Krankheit, sondern als normale Reaktion auf eine außergewöhnliche seelische Belastung. In der neuesten Fassung des Diagnosemanuals (ICD-11) findet man die akute Belastungsreaktion unter der Bezeichnung „akute Stressreaktion“.
Die PTBS entsteht zeitlich verzögert, häufig erst Wochen oder Monate nach dem Trauma. Sie ist u. a. gekennzeichnet durch:
- das Wiedererleben des Traumas (z. Flashbacks, Albträume),
- Vermeidung von Erinnerungen oder Situationen und
- eine anhaltende Übererregung (z. Schlafstörungen, Reizbarkeit).
Die PTBS ist eine psychische Erkrankung, die behandelt werden sollte.
Die sogenannte akute Belastungsstörung ist im ICD-10 nicht enthalten, sondern stammt aus dem amerikanischen Klassifikationssystem DSM-5. Sie beschreibt Symptome, die zwischen drei Tagen und einem Monat nach dem Trauma auftreten. Damit deckt sie den Zeitraum zwischen akuter Reaktion und PTBS ab. In Deutschland wird diese Diagnose offiziell nicht verwendet.