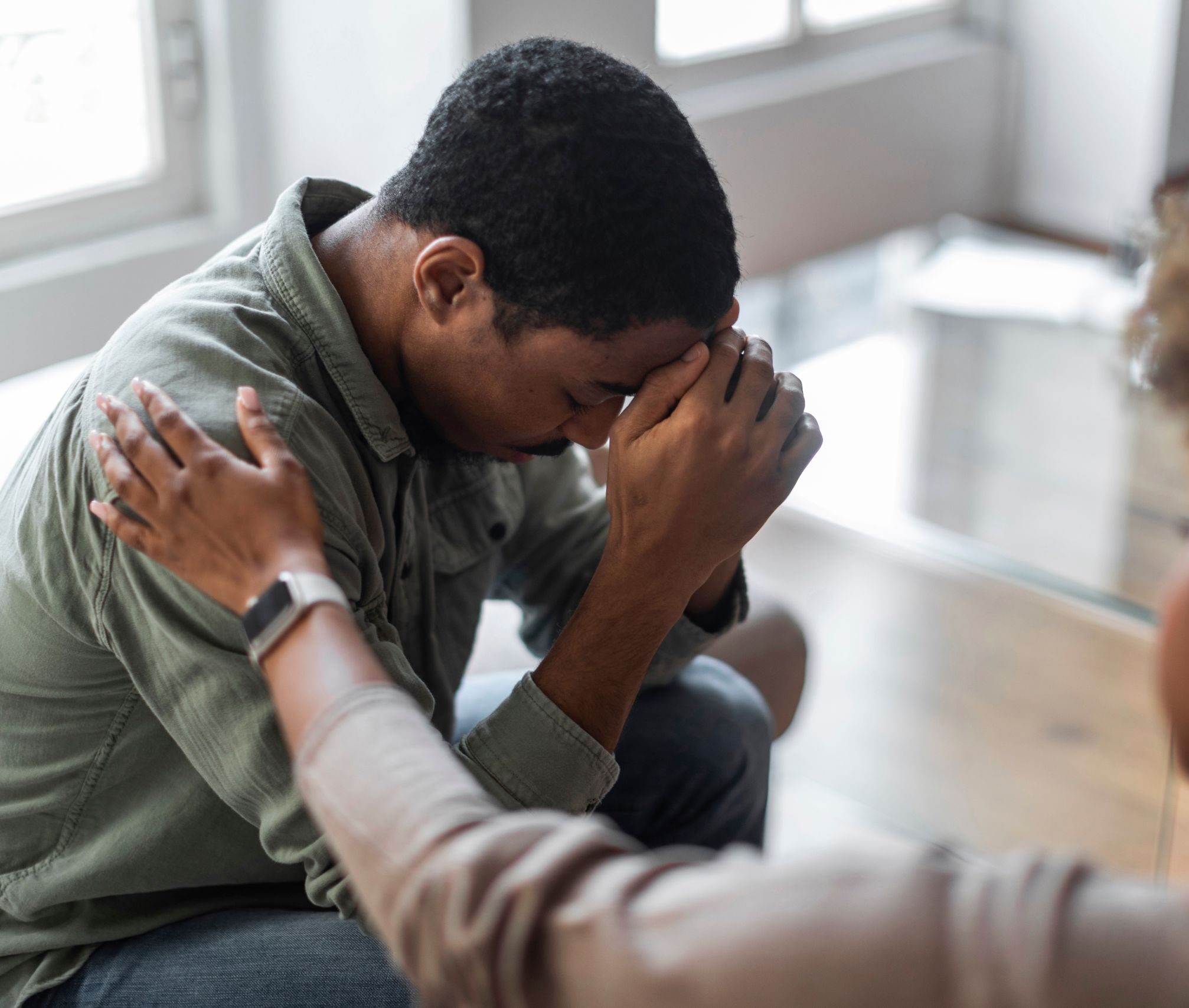Wer ist von posttraumatischen Belastungsstörungen betroffen?
Zahlreiche Ereignisse können eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) auslösen – darunter Verkehrsunfälle, Naturkatastrophen, körperliche oder sexuelle Gewalt, Krieg, Folter oder schwere medizinische Eingriffe.
Allerdings ist das Risiko, nach einem traumatischen Erlebnis eine PTBS zu entwickeln, nicht bei allen Ereignisarten gleich hoch. So führen Verkehrsunfälle statistisch deutlich seltener zu einer PTBS als sogenannte „man-made disasters“ wie Kriegserfahrungen, Vergewaltigungen oder Folter, bei denen die Betroffenen gezielt und oft wiederholt massiver Bedrohung und Ohnmacht ausgesetzt sind.
Auch individuelle Faktoren spielen eine wichtige Rolle – etwa das Alter beim Trauma, frühere traumatische Erfahrungen, soziale Unterstützung, genetische Disposition oder bestehende psychische Vorerkrankungen.
Schätzungen zufolge erleben rund 70 Prozent der Weltbevölkerung im Laufe ihres Lebens mindestens ein potenziell traumatisierendes Ereignis. Eine PTBS entwickelt jedoch nur ein vergleichsweise kleiner Teil: global betrachtet nur 5,6 Prozent.1 Frauen sind tendenziell häufiger betroffen als Männer – möglicherweise aufgrund einer höheren Exposition gegenüber bestimmten Traumaformen (z. B. sexualisierte Gewalt) und geschlechtsspezifischer Unterschiede in der Verarbeitung.