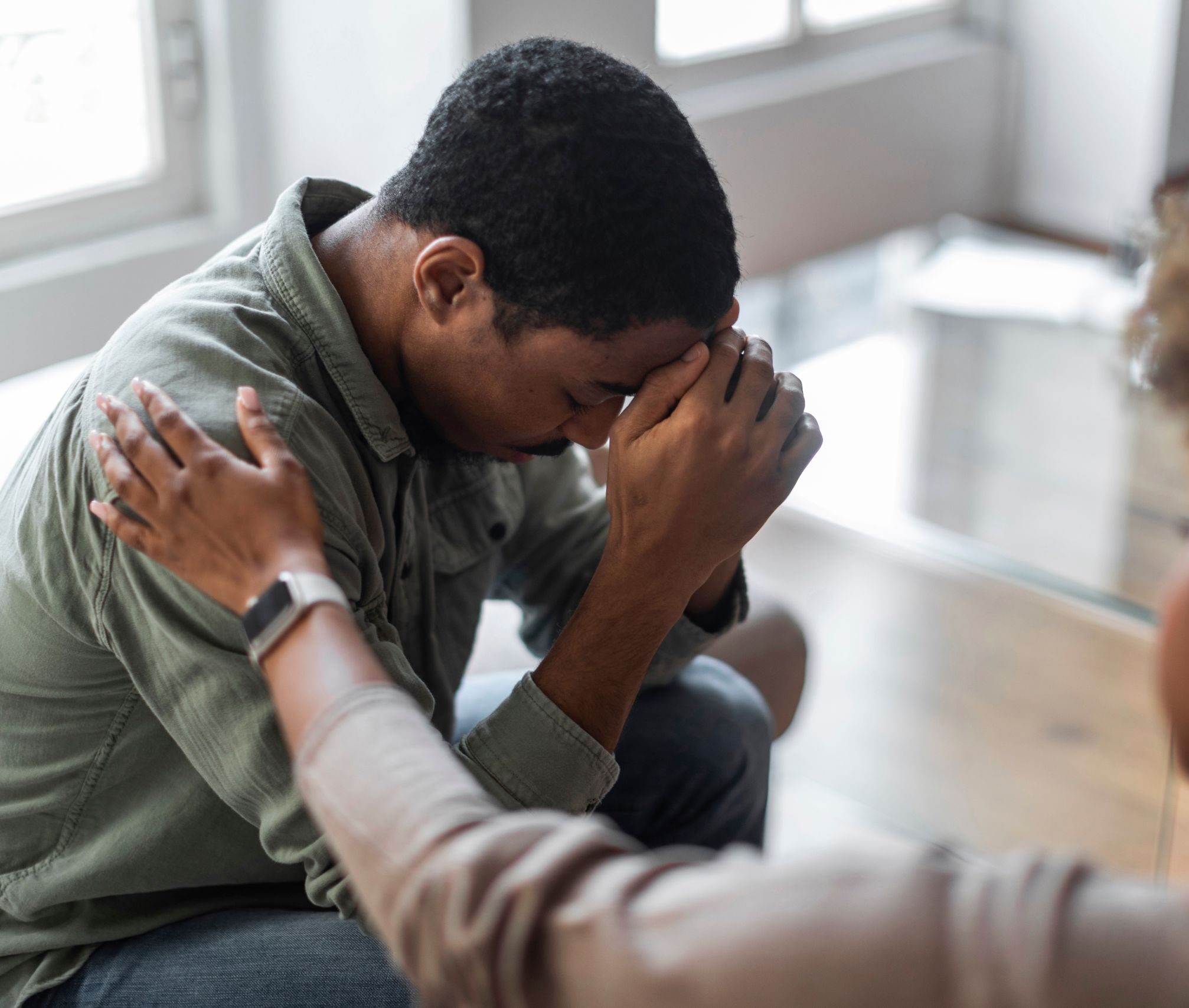Wie wird eine Abhängigkeitserkrankung diagnostiziert?
Suchtkrankheiten entwickeln sich meist über einen längeren Zeitraum. Zu Beginn glauben viele Betroffene, den Konsum bzw. das Verhalten unter Kontrolle zu haben. Oft suchen sie erst dann einen Arzt auf, wenn die Folgen der Erkrankung so belastend geworden sind, dass sie sich nicht mehr leugnen lassen. Der Hausarzt ist häufig der erste Ansprechpartner.
In einer ausführlichen Anamnese kann der Arzt die typischen Diagnosekriterien abfragen. In der Regel überweist der Hausarzt an einen Facharzt. Für die Diagnostik können strukturierte Fragebögen verwendet werden bzw. man orientiert sich an den Diagnosekriterien des ICD. Entscheidend ist eine ehrliche Selbstauskunft des Patienten. Gegebenenfalls kann es sinnvoll sein, Angehörige einzubeziehen.
Körperliche Auffälligkeiten oder auffälliges Verhalten können dem Arzt Hinweise auf eine Suchterkrankung geben. Dazu gehören mangelnde Körperhygiene, Hautveränderungen oder sichtbare Einstichstellen. Auf Verhaltensebene fallen insbesondere Nervosität, Unruhe, Zittern, Sprachstörungen oder Gereiztheit auf.
Anhand von Blut- oder Urinproben kann der Konsum eines Rauschmittels (begrenzt) nachgewiesen werden. Hinweise auf eine Abhängigkeit liefern diese Ergebnisse jedoch nicht. Trotzdem werden Laboruntersuchungen im Rahmen der Diagnosestellung häufig durchgeführt, da sich so zum Beispiel auch Folgeerkrankungen, wie etwa Leberschäden bei Alkoholsucht, feststellen lassen.